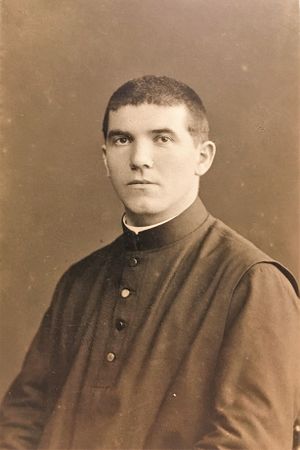Andreas Villiger: Unterschied zwischen den Versionen
Annina (Diskussion | Beiträge) |
Annina (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== Beziehungsnetz == | == Beziehungsnetz == | ||
=== Verwandtschaft === | === Verwandtschaft === | ||
| − | Sohn des Josef Villiger und der Barbara Rüttimann | + | Sohn des Josef Villiger und der Barbara Rüttimann. |
== Lebensbeschreibung == | == Lebensbeschreibung == | ||
Version vom 23. November 2017, 11:55 Uhr
Andreas (Eduard) Villiger (* 15. September 1886 von Sins; † 8. Oktober 1950)
Lebensdaten
Profess: 30. September 1910
Weihe: 28. Juni 1914
Ämter
Kooperator in Gries: 1914–1920, 1936–1950
Kooperator in Marling: 1920–1921
Vikar in Boswil: 1921–1925
Pfarrer in Boswil: 1925–1935
Beziehungsnetz
Verwandtschaft
Sohn des Josef Villiger und der Barbara Rüttimann.
Lebensbeschreibung
P. Andreas absolvierte das Gymnasium in Einsiedeln und trat 1909 ins Kloster Muri-Gries ein. Am 30. September 1910 legte er Profess ab und wurde am 28. Juni 1914 zum Priester geweiht. Zuerst war er Kooperator in Gries und kam 1920 als solcher nach Marling. Im September 1921 kam er als Vikar nach Boswil im Freiamt, wo er 1925 zum Pfarrer gewählt wurde. Die Kurie entzog ihm im Juni 1935 die Jurisdiktion (in den Professbuchnotizen steht: wegen Unvorsichtigkeit und Geschwätz). Danach kam er als Auxiliar nach Senale und wurde 1936 wieder Kooperator in Gries. Im Herbst 1936 übernahm er das Amt des Präses der Jünglingskongregation und Männerkongregation. 1948 erlitt er einen Herzinfarkt. Er starb am 8. Oktober 1950 an Wassersucht. Es hatten sich auch Baucheiterungen hinzugesellt, deren Ursprung unklar ist. Auf dem Totenbett soll er nochmals seine Unschuld hinsichtlich der Vorwürfe, die zu seiner Absetzung in Boswil geführt hatten, ausgesprochen haben. Er habe sehr gelitten wegen jener Absetzung.[1]
Werke
Einzelnachweise
- ↑ Notizen Professbuch P. Adelhelm Rast und P. Dominikus Bucher im Stiftsarchiv Muri-Gries in Sarnen sowie digitalisierte und erweiterte Ausgabe des Professbuchs von P. Vinzenz Gasser (Transkript P. Plazidus Hungerbühler).
Bibliographie
- Professbuch: Nr. 789.